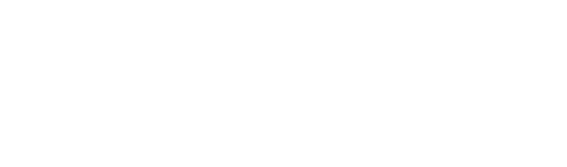Die Wettbewerbsfilme bei DOK Leipzig 2022 heben das Private im Dokumentarfilm stark hervor. Es findet eine Auseinandersetzung mit der eigenen Familie statt, Frauenrollen werden hinterfragt und Nachwirkungen des Kolonialismus aufgezeigt.
„Tropic Fever“ – Erinnerungen an Kolonialismus in Indonesien
Nicht immer ist persönliche Geschichte auch autobiographisch. In „Tropic Fever“ thematisiert das Regie-Trio Mahardika Yudha, Robin Hartanto Honggare und Perdana Roswaldy die Auswirkungen des Kolonialismus in Indonesien. Abgeholzte Wälder, zerstörte Natur und versklavte Menschen sind das Ergebnis ausbeuterischer Kolonialpolitik zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Eigentlich ist Robin Hartanto Honggare Architekt. Er recherchierte für seine Dissertation an der Columbia University, USA, als er Foto- und Filmaufnahmen aus den Jahren 1890 bis 1930 entdeckte. Aufgenommen wurden sie im ehemaligen Niederländisch-Indien; Gefunden hatte er sie in Amsterdamer Archiven. Sie berührten ihn so sehr, dass er beschloss, daraus einen Film zu machen, um sie einem größeren Publikum zeigen zu können. Honggare kontaktierte den indonesischen Künstler und Filmemacher Mahardika Yudha, sowie die Soziologin Perdana Roswaldy, wie er im DOK Industry Talk „Accessing Colonial History“ verriet.

Archive und ihr koloniales Erbe
Es begann eine intensive Auseinandersetzung mit dem vorhandenen Material. Es war eindeutig aus der Perspektive der Kolonialmacht zur Bewerbung ihrer Plantagen aufgenommen worden. Entstanden ist ein „Projekt“, wie es die Regisseur:innen nennen, das sich in drei Teile gliedert. Es ist teilweise mit Naturtönen unterlegt oder bleibt über lange Strecken stumm. Dazwischen spricht Perdana Roswaldy kurze Passagen aus dem semi-autobiographischen Roman des ungarischen Plantagenverwalters Ladislao Szekely. Er publizierte den Roman „Tropic Fever: Adventures of a Planter in Sumatra“ Anfang der 1930er Jahre.
„Tropic Fever“ ist eine künstlerische Arbeit, die mit wenig Budget umgesetzt wurde. Gerade in der minimalistischen Umsetzung fängt sie die Brutalität gegenüber der Bevölkerung und Natur ein. Es ist die erste Arbeit, die aus indonesischer Perspektive zu diesem Thema entstanden ist. Der Film lief in der Sektion „Internationaler Wettbewerb – langer Dokumentar- und Animationsfilm“. Robin Hartanto Honggare plant ihn auch in Indonesien zu zeigen, wo diese Aufnahmen nur innerhalb kuratierter Veranstaltungen gezeigt werden dürfen.
„Une mère“ – Fragen an eine abwesende Mutter

Als der französische Regisseur Mickaël Bandela sechs Monate alt war, übergab ihn seine leibliche Mutter Gisèle in die Obhut der Pflegemutter Marie-Thérèse, bei der er fast 20 Jahre lang aufwuchs. Der Kontakt zu Gisèle riss zwar nie ab, aber die Besuche blieben unregelmäßig. Der kleine Junge wartete oft tagelang vergebens. Jahre später gründet Mickaël eine Familie und stellt sich und seinen Müttern die Fragen, die ihn ein Leben lang beschäftigt haben. Warum nahm seine Pflegemutter Kinder aus anderen Familien auf, liebte sie ihre Pflegekinder genauso wie ihre eigenen Kinder und warum kümmerte sich seine leibliche Mutter nicht um ihn?
Unprivilegiertes Aufwachsen in der französischen Provinz
Für Mickaël kommen fragmentierte Erinnerungen hoch, die schönen Familienurlaube mit seiner Pflegefamilie, in der er sich aufgehoben fühlte, aber auch die Orientierungslosigkeit als junger Erwachsener. Mickaël Bandela gelingt ein wildes Porträt seines Lebens, in dem sich Vergangenheit und Gegenwart vermischen und in dem beide Mütter immer wieder zu Wort kommen. Der Regisseur kann auf wenig Archivmaterial zurückgreifen und geht spielerisch „cool“ mit Fotos, Dokumenten und inszenierten Aufnahmen um. Die Einschätzungen des Jugendamts werden eingeschnitten, ebenso die Aufnahmen seiner jungen Mutter, die zusammen mit ihrer Schwester aus dem Kongo nach Frankreich kam und deren größter Wunsch es war als Modell zu arbeiten.
Internationaler Preis der Filmkritik
„One Mother / une mère“ erhielt den Internationalen Preis der Filmkritik (FIPRESCI) mit der Begründung, dass der Regisseur ein vertrauensvolles Interviewumfeld für sich und seine beiden Mütter schafft und dadurch tiefe Gespräche ermöglicht. Es ist ein empathischer Film, der versöhnlich und offen mit Familienkonzepten umgeht. Bandela widmete ihn seinen Pflegeeltern.
„A Life Like Any Other“ – Beeindruckendes Privatarchiv
 Auch die Regisseurin Faustine Cros richtet den Blick auf ihre Mutter. Jahrelang filmte der Vater der Regisseurin seine junge, energiegeladene Frau, die Ankunft des ersten Kindes, das zweite Kind, den Familienalltag. Während er meint, die schönsten Momente des Lebens filmisch festzuhalten, wird Faustine Cros‘ Mutter Valérie zunehmend depressiv. Sie gibt ihre clownesken Einlagen als Hexe „La Valére“, doch dazwischen sitzt sie bewegungslos am Tisch und starrt vor sich hin. Ein anderes Mal spricht sie davon, die Enge des Alltags zu verlassen, um die Welt zu bereisen und realisiert doch, dass der Alltag ihre Freiheiten täglich reduziert.
Auch die Regisseurin Faustine Cros richtet den Blick auf ihre Mutter. Jahrelang filmte der Vater der Regisseurin seine junge, energiegeladene Frau, die Ankunft des ersten Kindes, das zweite Kind, den Familienalltag. Während er meint, die schönsten Momente des Lebens filmisch festzuhalten, wird Faustine Cros‘ Mutter Valérie zunehmend depressiv. Sie gibt ihre clownesken Einlagen als Hexe „La Valére“, doch dazwischen sitzt sie bewegungslos am Tisch und starrt vor sich hin. Ein anderes Mal spricht sie davon, die Enge des Alltags zu verlassen, um die Welt zu bereisen und realisiert doch, dass der Alltag ihre Freiheiten täglich reduziert.
Bruchstücke eines Lebens
Es sind die Brüche in dem Filmmaterial einer „glücklichen“ Familie, die Faustine Cros in ihrem Film „A Life Like Any Other“ herausarbeitet. In Faustines 12. Lebensjahr kommt es zu einer Gefühlsexplosion Valéries vor laufender Kamera. Danach hat ihr Vater nicht mehr gefilmt. Die Regisseurin setzt seinem jahrelangen Blick ein neues Narrativ entgegen und sucht den Dialog mit ihren Eltern.
Silberne Taube und Preis der Interreligiösen Jury
Für ihre feinen Beobachtungen erhielt Cros den Silberne Taube Nachwuchspreis, der von 3sat zum dritten Mal verliehen wurde und mit 6.000 Euro dotiert ist. In der Begründung der Jury heißt es: Der Film „A Life Like Any Other“ zeichnet das Porträt einer Frau, die mit der Mutterrolle und ihren Anforderungen hadert. „Der Film versucht, den Schmerz einer Familie zu verstehen, und gibt so dem Urschrei von Frauen, Ehefrauen und Müttern überall eine Stimme“. „A Life Like Any Other“ erhielt auch den mit 1.750 Euro dotierten Preis der Interreligiösen Jury.
„The Homes We Carry” – Hammer und Zirkel in Mosambik

Der Film beginnt mit einer wehenden DDR-Fahne während der Demonstration der „Madgermanes“ in Maputo, Mosambik. Nicht „mad Germans“ sagt Regisseurin Brenda Akele Jorde im Filmgespräch, sondern das sei der mosambikische Name für Vertragsarbeiter, die in der ehemaligen DDR lebten. Viele gründeten Familien, auch Eulidio. Nach dem Mauerfall müssen sie in ihre Heimatländer zurückkehren, werden für jahrelange Arbeit nicht entlohnt und hinterlassen Familien in Deutschland. Sarah ist Eulidios Tochter und wächst bei ihrer Mutter Ingrid in Berlin auf. Mit elf Jahren begegnet sie ihrem Vater zum ersten Mal und entdeckt, wie wohl sie sich fühlt, inmitten von Menschen mit ähnlich dunkler Hautfarbe. Als Erwachsene beschließt sie einige Zeit in Mosambik zu leben, sie wird schwanger und kehrt zurück nach Deutschland. Der Film begleitet sie über einen dreijährigen Zeitraum auf ihrer Suche nach Heimat und der Auseinandersetzung mit dem eigenen Vater und dem Vater ihrer Tochter Luana.
Los geht’s mit Afrodeutscher Geschichte
„The Homes We Carry“ ist Brenda Akele Jordes Abschlussarbeit an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf und ihr erster langer Dokumentarfilm. Bei der Premierenvorstellung sind ihre drei Hauptdarstellerinnen Ingrid Deichsel, deren Tochter Sarah und Enkelin Luana anwesend und sie sprechen darüber, wie es sich anfühlt, in Deutschland als Afrodeutsche zu leben. Während „Afroamerikaner“ ein gebräuchlicher Begriff ist, wird die Geschichte Afrodeutscher weitgehend ignoriert. Schwarz und deutsch, das existiert weder in Geschichtsbüchern, noch in unserem Bewusstsein. Das ändert Brenda Akele Jorde mit „The Homes We Carry“. Der Film erzählt mit Leichtigkeit und großer Ruhe, dass man in beiden Ländern, die unterschiedlicher kaum sein können, beheimatet sein kann. Jorde fängt ein, wie es sich anfühlt, eine große Familie in Afrika zu haben und in beiden Welten zu Hause zu sein. Unterstützt wird Sarahs selbstbewusster Weg durch die kraftvolle Musik der mosambikischen Sängerin Lenna Bahule.
Man wünscht sich mehr dieser Geschichten auf deutschen Bildschirmen.